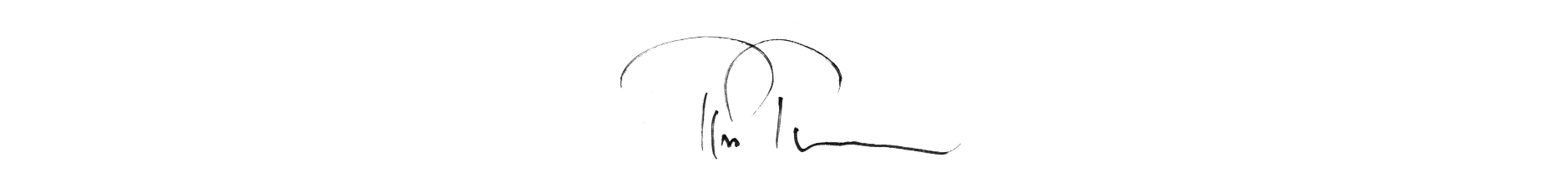Kolumne
Tim Thoelke über Rubbellose, Bären und Pfannkuchen
Als ich noch ganz neu in Leipzig war, ging ich eines Tages in einen Kiosk bei mir um die Ecke, um ein paar Kleinigkeiten zu kaufen. Ich war nicht das erste Mal dort, also schon vertraut mit dem 90er-Jahre-Charme der Bude und der zierlichen Mittfünfzigerin, die zwischen Tabakwaren, Zeitschriften, Kaugummis und Rubbellosen hinter dem Verkaufstresen routiniert ihr Tagwerk verrichtete. Während ich meine Ware zusammensuchte, verabschiedete sie sich noch ausführlich von einer älteren Kundin, um sich kurz darauf mir und meinem Einkauf zuzuwenden. Sie begrüßte mich höflich und begann mithilfe eines Taschenrechners, den Wert meiner Auswahl zu ermitteln. Währenddessen zog ich einen Zehn-Euro-Schein aus der Hosentasche, legte ihn auf den „Lord Extra“-Geldteller neben der Kasse und ließ den Blick durch das kleine Schaufenster nach draußen auf die Bornaische Straße schweifen. Es war ein schöner Tag im Frühling und meine neue Heimatstadt zeigte sich von ihrer besten Seite. Draußen zwitscherten die Vögel und ich hatte das sichere Gefühl, dass ich mit dem Umzug nach Leipzig eine außerordentlich gute Entscheidung getroffen hatte. In Gedanken versunken genoss ich die Idylle dieses sonnigen Moments, als plötzlich etwas passierte, das dieses friedliche Szenario auf einmal ins Absurde zu kippen schien: Die Verkäuferin blickte von ihrem Taschenrechner hoch, sah mich an und sagte unvermittelt: „Haben Sie manchmal 50 Cent?“
Ich glaubte im ersten Moment, sie falsch verstanden zu haben, und bat um Verzeihung, doch sie wiederholte ihren Satz, als würde er irgendeinen Sinn ergeben: „Haben Sie manchmal 50 Cent?“
Verzweifelt versuchte ich, das eben Gehörte zu verstehen. Offensichtlich eine vollkommen bizarre Frage, hatte doch jeder Mensch manchmal 50 Cent, genau wie jeder Mensch manchmal Schuhe anhatte oder manchmal auf einem Stuhl saß. Hätte mich die – mittlerweile etwas wunderlich wirkende Frau – gefragt, ob ich manchmal träumte, von einem Bären gefressen zu werden, oder manchmal Appetit auf Erdbeereis hätte, wäre das zwar auch nicht gerade der Situation angemessen, aber wenigstens nicht völlig verrückt gewesen.
„Und? Haben Sie?“, wiederholte sie ob meines Schweigens etwas verunsichert ihre Frage.
Also nickte ich langsam und antwortete, so ehrlich ich konnte: „Ja, ich habe manchmal 50 Cent.“
Leider trug meine Antwort jedoch nicht dazu bei, die Situation wieder zu entspannen. Im Gegenteil, die Atmosphäre in dem eben noch so reizenden Spätverkauf wurde immer seltsamer und unangenehmer.
Wir schwiegen beide und scheinbar wartete jeder auf den nächsten Schritt des anderen. Es war jetzt sehr ruhig in dem Laden. Eine gefühlte Ewigkeit passierte nichts weiter.
Dann durchbrach sie die Stille: „Kann ich sie haben?“, fragte sie etwas gehemmt und mit einem schiefen Lächeln im Gesicht.
„Was?“, fragte ich verwirrt.
„Na die 50 Cent“, sagte sie und sah mich entgeistert an.
„Welche 50 Cent?“
„Aber Sie sagten doch, Sie haben welche!“
Jetzt war ich völlig perplex. „Oh Gott, nein, ich habe überhaupt kein Kleingeld dabei.“
Sie kramte hastig mein Restgeld aus der Kasse und legte es auf den Geldteller. Sie sah mich an und trat einen Schritt zurück. „Ich mach dann jetzt zu.“
Mit hochrotem Gesicht und dem Gefühl, mich gerade wie ein Psychopath benommen zu haben, verließ ich den Laden wieder. Neben meinen Einkäufen nahm ich die Erkenntnis mit, dass man das Wort manchmal in Leipzig wie ein vielleicht oder eventuell benutzt.
Derartige Verwirrungen können mir nach 16 Jahren Pleißestadt natürlich nicht mehr passieren. Mittlerweile weiß ich, was ich bekomme, wenn ich einen Pfannkuchen bestelle (und ob ich ihn mit Staubzucker möchte oder nicht), dass Meiner keine Drohung, sondern etwas Gutes ist, und dass kein Leipziger in meiner Gegenwart jemals Ei verbibbsch gesagt hat.
Trotzdem gibt es immer mal wieder Überraschungen. So sitze ich kürzlich in einer alten Leipziger Eckkneipe und bestelle mit einem Kumpel ein Bier. Während der Kellner sich auf einem kleinen Block Notizen macht, fragt er beiläufig: „Mit Kompott oder ohne?“
Ohne mit der Wimper zu zucken, bestellt meine Begleitung „Mit“ und natürlich schließe ich mich sofort beherzt an.
Als der Kellner das Bier kurz darauf zusammen mit einem kleinen Wodka auf den Tisch stellt, denke ich: Und da soll mir noch mal einer sagen, Sächsisch wäre keine schöne Sprache!