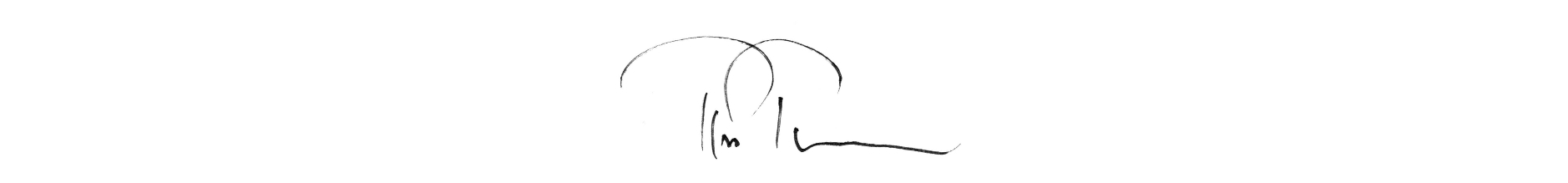Kolumne
Tim Thoelke über Kavaliere, WG-Partys und T-Shirts
Es gibt Dinge, die bei unseren Mitmenschen im Allgemeinen nicht so gut ankommen. Das wird jeder bestätigen, der im Büro schon mal vor einem Kollegen eine Handvoll Tabletten mit Whiskey heruntergespült hat oder nach dem Sport in der Umkleidekabine beim Stehlen von Wertgegenständen erwischt wurde. Jede Mutter, die mal ganz ehrlich gestanden hat, dass sie ihre Kinder uninteressant findet, kennt das und jeder Kavalier, der bei einem Spaziergang mit der neuen Freundin lachend einem Rentner den Stock weggetreten hat – wieso, ist doch witzig!
Nein, diese Dinge mögen wir nicht, das wissen wir alle. Was aber die meisten nicht wissen, ist, dass in diese Kategorie auch etwas fällt, das die Mehrheit für unverfänglich oder sogar unterhaltsam hält: einer Person zu sagen, dass sie einer anderen Person sehr ähnlich sieht.
Zum ersten Mal ist mir das aufgefallen, als ich vor vielen Jahren auf einer WG-Party in einer Zeitschrift blätterte und mein Blick auf das Foto einer jungen Frau fiel, die einer befreundeten Studentin, die ebenfalls anwesend war, auffallend ähnlich sah. Ich zeigte das Bild den mich umgebenden Menschen und alle gaben mir recht: Die beiden hätten Zwillinge sein können. Die besagte Studienkollegin wurde schnell auf das an ihr entfachte Interesse aufmerksam und fragte uns, was denn los sei. Daraufhin erzählte ich ihr von dem erstaunlichen Zufall und zeigte ihr vergnügt das Foto. Ihre Reaktion traf mich unerwartet: Statt sich über die Ähnlichkeit zu amüsieren, war sie verärgert und traurig – offensichtlich hielt sie das Ganze für einen schlechten Scherz. Trotz vieler Erklärungen und Entschuldigungen war sie schwer beleidigt und begrüßte mich in den folgenden Tagen nur mit zusammengebissenen Zähnen und sah mich dabei an wie einen Teller mit verdorbenem Fleisch.
Erst viel später, als mir selbst einmal eine große Ähnlichkeit mit einer (sogar recht prominenten) Persönlichkeit angedichtet wurde, erkannte ich, was das Problem an der Sache war. Genau wie besagte Studentin war ich nämlich gar nicht begeistert von dem Vergleich, hatte doch der mir angeblich so ähnliche Mann nichts, was ich selbst attraktiv gefunden hätte. Er sah irgendwie komisch aus, eher unvorteilhaft, ja, man mochte fast sagen: Der Ärmste war ein bisschen hässlich geraten.
Der Grund für diese Antipathie gegenüber Menschen, die uns sehr ähnlich sind, ist aber nichts Ungewöhnliches, er ergibt sich schon aus der Biologie.
So führte der Schweizer Biologe Claus Wedekind 1995 eine Studie durch, welche als »MHC-Dependent Mate Preferences in Humans« bekannt wurde und die er mithilfe von 49 Studentinnen und 44 Studenten der Universität Bern umsetzte. Dabei bestand die Aufgabe der Probandinnen darin, an jeweils sechs T-Shirts zu schnüffeln, die zuvor von den männlichen Studenten zwei Nächte lang beim Schlafen getragen wurden. Deodorants und Parfüms waren den Männern in dieser Zeit verboten, genauso Lebensmittel und Aktivitäten, die störende Gerüche verursachen können, wie zum Beispiel Rauchen, Drogen, Sex, Alkohol (als quasi alles, was ein Studentenleben ausmacht). Die Frauen mussten dann bewerten, für wie angenehm und sexy sie den Geruch halten.
Untersucht werden sollte, ob die Studentinnen eher die T-Shirts von Männern mögen, deren Gene ihren eigenen sehr ähnlich sind oder umgekehrt. Der Grad der Ähnlichkeit wurde vorher durch die Analyse des jeweiligen Haupthistokompatibilitätskomplex (engl. major histocompatibility complex, kurz MHC) der Probanden ermittelt, der eine Kette von ineinander gekoppelten Genen beschreibt, welche unser Immunsystem nutzt, um körpereigene von körperfremden Strukturen zu unterscheiden.
Da das Immunsystem unserer Nachkommen stärker wird, je unterschiedlicher die MHC-Gene von Mutter und Vater sind, wurde vermutet, dass der MHC und die Fähigkeit, diesen (z. B. über den Geruchssinn) zu identifizieren, eine wesentliche Rolle bei der Auswahl von potenziellen Partnern spielt. Bisher hatte man diese Präferenz allerdings nur bei Mäusen und Fischen nachweisen können.
Das Ergebnis der Berner Studie war eindeutig und bestätigte schließlich die Theorie: Die große Mehrheit der Frauen bevorzugte den Geruch von Männern, die gegensätzliche MHC-Gene haben.
Womit wir wieder bei unseren unfreiwilligen Gesichts-Zwillingen wären: Dass wir Personen, die uns sehr ähnlich sehen, nicht besonders attraktiv finden, könnte daran liegen, dass wir eher einen Partner suchen, der das Gegenteil von uns ist – weil wir, ob wir es wollen oder nicht, immer schon den zweiten Schritt mitdenken, nämlich den besten Gen-Pool für unsere Kinder herauszuholen.
Oder wie Oma schon immer gesagt hat: Gegensätze ziehen sich an.