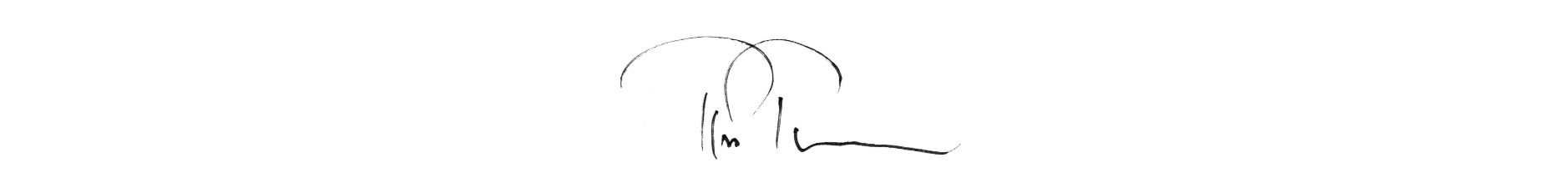Kolumne
Tim Thoelke über Karaoke-Opfer, Trash-Abende und Bass-Tsunamis
Im Januar war ich zum ersten Mal beim Leipziger Neujahrssingen. Obwohl ich schon viel über diese Veranstaltung gehört hatte, erschien es mir im ersten Moment überschaubar reizvoll, Leipzigs Gastronomen singen zu hören. Mir fielen wenig Gründe ein, warum Kneipen-Mitarbeiter stimmlich besser aufgestellt sein sollten als das gängige Karaoke-Opfer. Dass die Schar der Auftretenden mittlerweile auch auf singende Medienvertreter erweitert wurde, machte die Sache in meiner Vorstellung sogar noch unschöner.
Von daher war ich recht skeptisch, als die Organisatorin des Neujahrssingens mich fragte, ob ich nicht gesanglich etwas zu diesem Abend beitragen möchte. Sie skizzierte mir den Umfang des Spektakels, bei dem annähernd zweitausend Besucher ins Haus Leipzig kommen und für das eine Karte fast zwanzig Euro kostet – ein Preis, den ich erst einmal für relativ sportlich hielt, immerhin geht es hier um ein Konzert, bei dem nur Amateure singen. In der weiteren Erklärung wurde aber schnell klar, dass der Eintritt alles andere als zu hoch angesetzt ist, denn der Gewinn des Abends wird für richtig gute Zwecke gespendet: Straßenkinder, Straßenzeitung, Flüchtlingsrat, Kulturpaten.
Im weiteren Gespräch kam mir in den Sinn, dass ich „Killing In The Name“ gerne mal singen würde. Ein Song von Rage Against The Machine, einer Crossover-Kapelle, die Anfang der Neunziger Musikgeschichte geschrieben hat, indem sie Metal, Funk, Hardcore und Hip-Hop zusammenfügte. Da deren Songs in puncto Intensität und Lautstärke aber, sagen wir, ein wenig aus dem Raster des Neujahrssingens fallen, stand folgende Frage im Raum: „Kann die Band das spielen?“
„Die Band kann alles spielen“, wurde mir versichert.
Und sie konnte. Aber nicht nur die Qualität der Band, sondern auch die der Sängerinnen und Sänger war verblüffend hoch, von Karaoke kaum eine Spur. Noch erstaunlicher aber die Ernsthaftigkeit, mit der die ganze Veranstaltung zelebriert wird, vom Intro über den Einlauf der Protagonisten (mit Fahnenträger) bis zu der ZDF-Fernsehgarten-artigen Präsentation inklusive Zugaben-Pflicht und Schlussbild. Wer sich hier auf einen vor Schadenfreude triefenden Trash-Abend gefreut hat, wird enttäuscht – alle anderen freut es. Sollte man als Leipziger tatsächlich mal erlebt haben.
Nach meinem Auftritt wurde ich von mehreren Seiten gefragt, warum ich mich beim Neujahrssingen ausgerechnet für so eine rustikale Nummer wie „Killing In The Name“ entschieden habe. Mit Rage Against The Machine verbindet mich tatsächlich eine besondere Geschichte:
1992 spielte meine damalige Lieblingsband Suicidal Tendencies im legendären Club PC 69 in Bielefeld. Natürlich fuhr ich hin und da ich die Jungs bis dato noch nie live gesehen hatte, war ich sehr gespannt, um nicht zu sagen etwas nervös. Als es dunkel im Saal wurde, stellte ich allerdings schnell fest, dass nicht meine Helden die Bühne betraten, sondern eine unerwünschte Vorband. Doch die Enttäuschung wich fast augenblicklich der Erkenntnis, dass ich an diesem Abend Zeitzeuge einer musikalischen Zäsur wurde: Mit dem ersten Ton rollte ein gigantischer Bass-Tsunami durch die Reihen, ein Groove, der so sämig war, dass er meine Knie unwillkürlich um einige Zentimeter beugte. Eine Sekunde später flog ein Mann über die Bühne, der dreißig Arme zu haben schien (wovon sich später allerdings 28 als Dreadlocks herausstellten), und schrie wie von der Tarantel gestochen: „Burn, burn, yes, yo gonna burn!“ Mich erfassten Welle um Welle aus monströsem Beat und nie gehörte, verstörend wirkende Gitarrensoli. Verzweifelt versuchte ich, gerappte und geschriene Textpassagen aufzusaugen. Die nächsten vierzig Minuten stand ich einfach da und ließ die großartigste Band der Neunzigerjahre auf mich einprasseln.
Nach diesem Naturereignis ging ich wie betäubt zur Kasse und fragte nach dem Namen der Vorband, doch niemand kannte ihn. Ich ging zum Merchandise-Stand, doch es gab kein einziges Produkt dieser Band. Schließlich raunte mir ein Ordner zu: „Die heißen Rage.“ Ich war verwirrt, denn ich kannte eine Band mit diesem Namen, eine deutsche Power-Metal-Combo, die unmöglich das eben gesehene Quartett sein konnte. Derweil spielten Suicidal Tendencies bereits, doch ich wusste längst, dass sie nur noch meine Zweit-Lieblings-Band waren. Ihr Konzert war nett, sehr gut. Doch in meinem Herzen pochte es immer wieder: Rage – Rage – Rage.
Später fand ich in einem Musikmagazin den vollständigen Bandnamen, doch zu meinem Entsetzen zuckte mein Plattenhändler nur mit den Schultern – es gab keine einzige Veröffentlichung der Gruppe.
Einige Wochen später rief mich ein Freund an. Er habe sie gerade bekommen, teilte er mir aufgeregt mit, die CD von diesen Typen, von denen ich immer erzählte: Rage Against The Machine! Und dass ich in den Club kommen soll, in dem er als Techniker arbeitet. Als ich dort ankam, hatte er im Konzertraum bereits die große Tonanlage aufgebaut. In der Mitte des leeren, eigentlich 500 Personen fassenden Saals stand ein CD-Player auf einem kleinen Hocker, davor zwei Stühle. „Ich hab noch nicht reingehört, ich wollte warten, bis du da bist“, versicherte er mir. Wir setzten uns, er nickte mir kurz zu. Dann drückte er auf Play.
Eine Stunde später waren wir fast taub und für immer Fans.